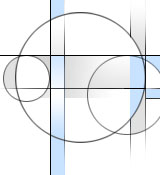

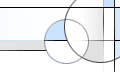



Marcel Dobberstein: Neue Musik. 100 Jahre Irrwege. Eine kritische Bilanz. Wilhelmshaven 2007.
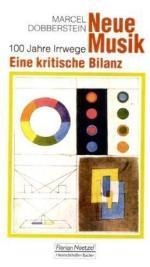 Das Experiment ist gescheitert. Die „Neue Musik“ ist ein Irrtum. Im Begriffe, 100 Jahre alt zu werden, genießt sie jedoch bereits den Schutz musealer Pietätsreminiszenzen und braucht in der postmodernen Situation Kritik nicht fürchten. Wie kann dies sein, wo doch Wissenschaft und Hörerschaft den Irrtum erwiesen? Das Musikdenken ist seit den Tagen der Pythagoreer gespalten zwischen pragmatischer Sachvernunft und haltloser Spekulation. Gleichwohl: Die Spekulation konnte der kompositorischen Ratio ehedem wenig anhaben. Die Hörkonvention band die Praxis an die Vernunft des lebendigen Ohres. Die Nachfahren Schönbergs entschlagen sich dem. Trotzig und gedankenartistisch suggerieren sie, ihr Tun sei versichert und ließe die Zukunft gewinnen. Nichts davon ist wahr. Die Kritik erkennt nur die Anatomie einer esoterischen Verirrung. Und einem redlichen Buch über die Neue Musik kann es dann einzig um die Frage gehen, wie sie möglich war und möglich ist; im Angesicht der Tatsache, daß alle Rechtfertigung, die für sie getan war, die Welt der Musik und die Welt überhaupt auf den Kopf stellt.
Das Experiment ist gescheitert. Die „Neue Musik“ ist ein Irrtum. Im Begriffe, 100 Jahre alt zu werden, genießt sie jedoch bereits den Schutz musealer Pietätsreminiszenzen und braucht in der postmodernen Situation Kritik nicht fürchten. Wie kann dies sein, wo doch Wissenschaft und Hörerschaft den Irrtum erwiesen? Das Musikdenken ist seit den Tagen der Pythagoreer gespalten zwischen pragmatischer Sachvernunft und haltloser Spekulation. Gleichwohl: Die Spekulation konnte der kompositorischen Ratio ehedem wenig anhaben. Die Hörkonvention band die Praxis an die Vernunft des lebendigen Ohres. Die Nachfahren Schönbergs entschlagen sich dem. Trotzig und gedankenartistisch suggerieren sie, ihr Tun sei versichert und ließe die Zukunft gewinnen. Nichts davon ist wahr. Die Kritik erkennt nur die Anatomie einer esoterischen Verirrung. Und einem redlichen Buch über die Neue Musik kann es dann einzig um die Frage gehen, wie sie möglich war und möglich ist; im Angesicht der Tatsache, daß alle Rechtfertigung, die für sie getan war, die Welt der Musik und die Welt überhaupt auf den Kopf stellt.
ISBN 3-7959-0886-8 303 S.
Marcel Dobberstein: Die Natur der Musik. Frankfurt am Main 2005.
 Der Musikforschung ist eine zentrale Frage gestellt: „Was ist Musik?“ Deren Beantwortung hat in Jahrtausenden unter falschen Autoritäten kaum Fortschritte machen können. Nachfrage, Aufklärung, Kritik, die eine sachliche Antwort voraussetzt, ist der Forschung samt ihrem Gegenstand zuletzt noch abhanden gekommen. Die Musikreflexion tendiert heute weithin dazu, sich ein Refugium genügsamer Deskription zu schaffen, mehr ein künstliches als denn ein künstlerisches oder wissenschaftliches. Es war zuletzt darin eine Welt der Unterschiedslosigkeit allgemein, mit der das Natürliche, Gesetzmäßige, Notwendige in der Musik in Abrede gestellt oder als irrelevant dargestellt wird. Diese postmoderne Welt der Unterschiedslosigkeit korrespondiert nur bedingt mit der realen Welt und der realen Musikwelt. Das heute vorherrschende Musikdenken, das Schönbergs, das von Theoretikern wie Carl Dahlhaus und Hans Heinrich Eggebrecht, bedarf grundlegender Revision. Das Buch kritisiert die zeitgemäßen Aufstellungen und konterkariert sie durch eine anthropologische Lösung jener Wesensfrage. Es resultiert die Erkenntnis: Es gibt eine Natur der Musik. Das Schwanken zwischen Spannungen und Auflösungen, das Musik konstituiert, ist ein tonhaftes Ebenbild leibseelischer Gegebenheiten. Das Tönen findet in jeweiligen systemisch tonsprachlichen Zusammenhängen statt, die wiederum Manifestationen des Leibseelischen sind. Zuletzt spricht der Mensch durchs Material mit sich selbst. Die Natur der Musik ist die Natur des Menschen in Tönen.
Der Musikforschung ist eine zentrale Frage gestellt: „Was ist Musik?“ Deren Beantwortung hat in Jahrtausenden unter falschen Autoritäten kaum Fortschritte machen können. Nachfrage, Aufklärung, Kritik, die eine sachliche Antwort voraussetzt, ist der Forschung samt ihrem Gegenstand zuletzt noch abhanden gekommen. Die Musikreflexion tendiert heute weithin dazu, sich ein Refugium genügsamer Deskription zu schaffen, mehr ein künstliches als denn ein künstlerisches oder wissenschaftliches. Es war zuletzt darin eine Welt der Unterschiedslosigkeit allgemein, mit der das Natürliche, Gesetzmäßige, Notwendige in der Musik in Abrede gestellt oder als irrelevant dargestellt wird. Diese postmoderne Welt der Unterschiedslosigkeit korrespondiert nur bedingt mit der realen Welt und der realen Musikwelt. Das heute vorherrschende Musikdenken, das Schönbergs, das von Theoretikern wie Carl Dahlhaus und Hans Heinrich Eggebrecht, bedarf grundlegender Revision. Das Buch kritisiert die zeitgemäßen Aufstellungen und konterkariert sie durch eine anthropologische Lösung jener Wesensfrage. Es resultiert die Erkenntnis: Es gibt eine Natur der Musik. Das Schwanken zwischen Spannungen und Auflösungen, das Musik konstituiert, ist ein tonhaftes Ebenbild leibseelischer Gegebenheiten. Das Tönen findet in jeweiligen systemisch tonsprachlichen Zusammenhängen statt, die wiederum Manifestationen des Leibseelischen sind. Zuletzt spricht der Mensch durchs Material mit sich selbst. Die Natur der Musik ist die Natur des Menschen in Tönen.
ISBN 3-631-54389-1 390 S.
Marcel Dobberstein: Musik und Mensch. Grundlegung einer Anthropologie der Musik. Berlin 2000.
 Musikgeschichte und Musikgebrauch vom hörenden Menschen aus verstehen zu wollen, setzt eine grundlegende Neuorientierung in der Betrachtung musikalischer Phänomene voraus. Erst aus anthropologischer Perspektive eröffnen sich dem Blick elementare Motivationen zur musikalisch-künstlerischen Tätigkeit. Zugleich wird die Einbettung kultureller Prozesse in einen Möglichkeitsrahmen sichtbar, der mit der "anthropologischen Struktur" gegeben ist.
Musikgeschichte und Musikgebrauch vom hörenden Menschen aus verstehen zu wollen, setzt eine grundlegende Neuorientierung in der Betrachtung musikalischer Phänomene voraus. Erst aus anthropologischer Perspektive eröffnen sich dem Blick elementare Motivationen zur musikalisch-künstlerischen Tätigkeit. Zugleich wird die Einbettung kultureller Prozesse in einen Möglichkeitsrahmen sichtbar, der mit der "anthropologischen Struktur" gegeben ist.
ISBN 3-496-02491-7 487 S.
Marcel Dobberstein: Die Psychologie der musikalischen Komposition. Umwelt – Person – Werkschaffen. Köln-Rheinkassel 1994.

ISBN 3-92566-32-6
247 S.
Artes Liberales (Festschrift). Karlheinz Schlager zum 60. Geburtstag. Hrsg. von Marcel Dobberstein, Tutzing 1998.
ISBN 3-7952-0932-3 472 S.
